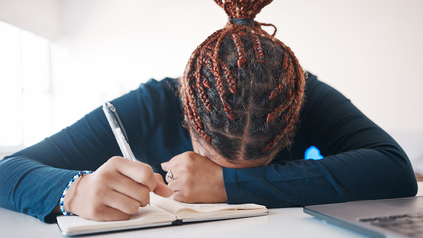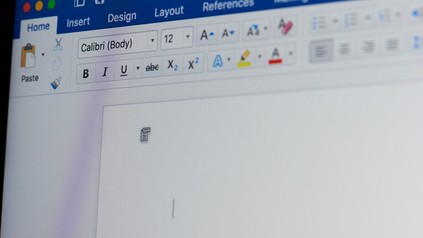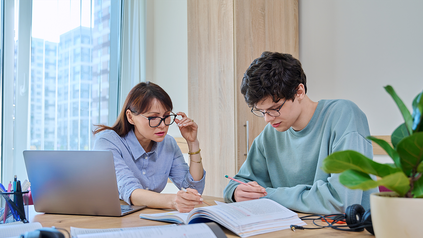Bachelorarbeit : Alles Wichtige auf einen Blick
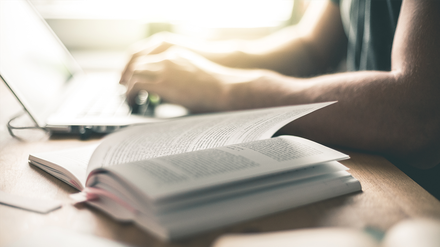
Du hast vermutlich schon mindestens eine Hausarbeit verfasst und dadurch schon ein wenig Übung im wissenschaftlichen Schreiben. Das ist gut, denn für deine erste Abschlussarbeit wird dir das helfen. Lass dich aber nicht dadurch verunsichern, dass die Bachelorarbeit so groß und wichtig klingt – denn im Grunde ist sie auch nichts anderes als eine längere, besser ausgearbeitete und detailliertere Hausarbeit.
Weil sie aber im Verhältnis zu den anderen wissenschaftlichen Texten punkte-technisch mehr hergibt und auch in deinem Abschlusszeugnis auftaucht, ist es natürlich trotzdem wichtig und richtig deine Bachelorarbeit ernst zu nehmen und sie gut hinter dich zu bringen.
Deswegen haben wir für dich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, die alles Wichtige enthält, was du für die Vorbereitung, Planung, Themenfindung, den Schreibprozess und mehr wissen solltest:
- Thema eingrenzen
- These überlegen
- Betreuer:in finden
- Erste Recherche
- (Arbeits-)Gliederung erstellen
- Einleitung schreiben
- Theorieteil aufbereiten
- Hauptteil erarbeiten
- Fazit zusammenfassen
- Literaturverzeichnis erstellen
- Anpassungen vornehmen
- Korrigieren
- Deckblatt und eidesstattliche Versicherung nicht vergessen
- Abgeben
- Auf Ergebnis warten
Thema überlegen/eingrenzen
Der erste Schritt bei jeder wissenschaftlichen Arbeit ist das Thema. Das heißt aber nicht, dass du von Anfang an schon ganz genau und im Detail wissen musst, worüber du schreibst, sondern nur, dass du dich damit auseinandersetzen solltest. Bringe in Erfahrung, wie das mit den Bachelorarbeits-Themen in deinem Fach abläuft, ob sie bspw. frei wählbar sind oder vorgegeben werden. Denn das Zweitere schränkt deine Auswahl schon mal stark ein.
Kannst du in irgendeiner Art selbst aussuchen, über welches Thema du schreibst, rate ich dir eines zu nehmen, in dem du dich gut auskennst und das dich interessiert. Bei der ersten großen Wissenschaftsarbeit einen Bereich zu wählen, in dem du gar keine Erfahrung/kein Wissen hast, ist einfach unklug – genauso etwas zu nehmen, das du absolut nicht ansprechend findest. Du wirst dich nämlich ein paar Monate mit deiner Arbeit befassen müssen, stelle also sicher, dass du dich dabei irgendwie motiviert bekommst.
Was solltest du bei der Themenwahl beachten?
- Passt das Thema zu deinem Studienfach? – Deine Bachelorarbeit muss in irgendeiner Weise einen Bezug zu deinen Studieninhalten haben.
- Kannst du dir vorstellen, dich mehrere Monate damit zu befassen? – Recherchieren, sprechen, denken, schreiben – und das zu und über das Thema, kann schnell langweilig werden, wenn du keinen Bereich wählst, den du irgendwie spannend findest.
- Gibt es genug Quellen und Forschungsliteratur zu dem Thema? – Valide Frage, weil du nicht (jedenfalls für die B.A.-Arbeit unratsam) an etwas arbeiten möchtest, zu dem es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt.
- Lassen sich darin Forschungsfragen, also Thesen, finden? – Der beste Inhalt bringt dir nichts, wenn du daraus keine neuen Erkenntnisse gewinnen kannst. Achte also schon bei der Themenwahl darauf, dass du mit dem Bereich, den du gewählt hast, arbeiten kannst.
Von der Themenauswahl erschlagen?
Kein Problem. Du kannst dir mehrere (nicht mehr als 3) aussuchen und sie erstmal potenziellen Betreuer:innen vorstellen – ihr könnt dann gemeinsam diskutieren, welches Thema am besten passt.
These überlegen
In jeder wissenschaftlichen Arbeit, egal ob Hausarbeit, Masterarbeit oder Bachelorarbeit steht und fällt deine Argumentation mit der These. Dabei handelt es sich um einen Foschungsfrage, die im Verlauf des Textes erörtert, kritisch hinterfragt, be-/wiederlegt oder bewiesen wird. Die These muss selbst nicht als Frage formuliert werden, sondern kann auch ein neuartiger Forschungsansatz sein, den du prüfst.
Wie beim Thema, solltest du dir auch bei deiner These überlegen, ob sie genug Stoff, Quellen und Co. hergibt, um die Seiten deiner Arbeit zu füllen. Außerdem ist es wichtig deine Forschungsfrage immer mit dem/der Betreuer:in deiner Bachelorarbeit abzusprechen – und zwar so genau wie möglich.
Im Grunde liefert dir die These eine Art roten Faden für den Aufbau, die Argumentationsstruktur und das Ziel deiner Arbeit. Genau aus diesem Grund solltest du sie möglichst früh formulieren können, denn sie setzt den Zweck und die Perspektive deines Textes.
Die richtige These wählen
Welche Forschungsfrage für dich, dein Studienfach, deinen Themenbereich interessant und passend ist, richtet sich natürlich auch stark nach deinem Fachgebiet, den Anforderungen an deine Bachelorarbeit und den Wünschen deiner Betreuenden.
Lass dich also von deinen Studiengangskoordinator:innen, Dozierenden und vor allem der Lehrperson, die deine Arbeit betreuen wird, bei der Wahl unterstützen.
Die Antwort auf deine These ist eigentlich immer auch gleichzeitig die Antwort auf folgende Fragen:
- Was ist der Sinn deiner Bachelorarbeit?
- Welche neuen Erkenntnisse hast du gewonnen?
- Wie lässt sich deine Arbeit im Forschungsstand des Themengebietes verorten?
Betreuer:in finden
Wenn du dich im vorletzten oder letzten Bachelorsemester befindest und (ungefähr) weißt, worüber du deine Abschlussarbeit schreiben könntest, geht es daran, jemanden zu finden, der dich dabei unterstützt. Jede Bachelorarbeit wird von eine:r Dozierenden betreut, die/der dich bei Thema, These, Inhalt, Struktur, Quellen und Co. berät. Deine Arbeit wird dann auch von dieser Lehrperson benotet.
Was du bei der Betreuer:innen-Suche beachten solltest:
- Nicht jede:r Dozierende kann Abschlussarbeiten betreuen, d.h.: informier dich vorab, welche Lehrpersonen deines Lehrstuhls dafür freigeschaltet sind.
- Passen die Forschungsschwerpunkte oder das Fachwissen des/der Dozierenden zu meinem Thema? Das sollte der Fall sein, denn nur so kann dein:e Betreuer:in dich optimal unterstützen.
Setz dich rechtzeitig mit dem Thema Betreuung auseinander
Nicht immer hat dein:e Wunschdozent:in sofort einen Betreuungsplatz für dich frei. Tritt also immer mit mehr als einer Lehrperson in Kontakt und plan auch ein paar Wochen Wartezeit mit ein.
Sobald du eine:n Dozierende:n gefunden hast, der/die deine Arbeit betreut, solltest du mit ihm/ihr über deinen Zeitplan reden: Wann willst/musst du deine Bachelorarbeit abgeben und wann solltest du sie anmelden? Nach erfolgreicher Anmeldung läuft dann die Bearbeitungszeit, heißt: melde deine Arbeit nicht zu früh an.
Erste Recherche
Wenn du nicht schon für die Themen-/Thesenauswahl bestimmte Sachen anrecherchiert hast, ist spätestens, wenn du eine:n Betreuer:in gefunden hast, der Zeitpunkt gekommen, an dem du dich mit Forschungsliteratur, potenziellen Quellen, Expertenmeinungen und Co. auseinandersetzen solltest.
Lies also mal quer in Texte und Theorien rein, die dir dabei helfen können, deine Arbeit thematisch aufzubauen und deine These zu belegen. Übrigens sind auch Forscherstimmen, die deinem Forschungsansatz widersprechen, wertvoll – nimm auch sie mit auf, denn das zeigt, dass du dich mit dem Wissenschaftsdiskurs befasst hast und dich auch mit Gegenmeinungen auseinandergesetzt hast.
Die erste Recherchearbeit bildet immer die Grundlage für alles, was danach noch kommt, deine Gliederung, deinen Theorieteil, deine Argumentation u.s.w. Sei also gründlich und sammel dir Material zusammen, das dir nützlich erscheint.
Übrigens kannst du auch, bei Schwierigkeiten oder Unsicherheiten, auf deine:n Betreuer:in zugehen und ihn/sie darum bitten, dir für den Start ein paar Wissenschaftler:innen, Autore:innen, Fachtexte etc. zu nennen, auf denen du deine weitere Recherchearbeit aufbauen kannst.
(Arbeits-)Gliederung erstellen
Wichtig für das weitere Vorgehen und etwas, das du definitiv machen solltest, bevor du auch nur dran denkst loszuschreiben, ist eine Arbeitsgliederung. Versuch dir wichtige Schritte zu überlegen, die du für deine Bachelorarbeit brauchst und halte sie in einer Gliederung fest.
Keine Sorge, denn die Arbeitsgliederung ist nur für dich und muss nicht so bleiben – sie kann (und wird) sich dann im Recherche- und Schreibprozess ändern, erweitern, kürzen. Das ist okay, nur erstmal geht es darum, dir für dich und deine Forschungsarbeit eine Struktur zu überlegen und sie aufzuschreiben. Das hilft, glaub mir.
Seitenzahlen-Hack: Bewahre den Überblick
Deine Bachelorarbeit soll im Schnitt 40 Seiten haben, davon jeweils 5 bis 10 %, also 2 bis 4 Seiten für Einleitung und Schluss und 20 bis 40 %, also 8-16 Seiten für den Theorieteil.
Und genau dieses Seitenvolumen kannst du dir in deine Arbeitsgliederung reinpacken, um den Überblick zu bewahren, wie lang und wie kurz etwa bestimmte Passagen sein sollen.
Einleitung schreiben
Die Einleitung ist bei wissenschaftlichen Arbeiten so wichtig, weil sie am Anfang steht und i.d.R. auch als Erstes gelesen wird. Sie ist damit für deine:n Prüfer:in der erste Anhaltspunkt dafür, wie gelungen deine Bachelorarbeit ist. Wieso? Weil in ihr im Kleinen alle wichtigen Punkte und Aspekte deines Textes enthalten sein sollten.
Formatvorlagen beachten
An jeder Fakultät/jedem Lehrstuhl gibt es bestimmte Formatvorlagen für wissenschaftliche Arbeiten, in der Schriftarten, -größen, Zeilenabstände, Zitierstil und viel mehr abgebildet sind – halte dich bei deiner Bachelorarbeit daran.
Das Dokument findest du online über deinen Lehrstuhl oder das Prüfungsamt. Falls nicht, frag bitte deine:n Betreuer:in.
Was gehört in die Einleitung deiner Bachelorarbeit?
- Thema: der Bereich, mit dem du dich befasst, sollte hier schon kurz zusammengefasst werden.
- These: auch deine Forschungsfrage sollte auftauchen und kontextualisiert werden.
- Forschungsstand: Hauptquellen, sowie eine Einbettung deines Themas und vor allem deiner These in die aktuelle wisschenschaftliche Forschung, darf ebenfalls nicht fehlen.
- Methodik: gehe kurz darauf ein, wie und auf welche Weise du dich in deiner Arbeit mit deinen Schwerpunkten auseinandersetzen willst
- Aufbau/Struktur: in der Einleitung solltest du auch auf die wichtigsten Schritte, also Gliederungspunkte, eingehen, die Leser:innen in deinem Text erwarten.
- Ziel: schon am Anfang deiner Bachelorarbeit solltest du benennen können, worauf du am Ende der Arbeit hinauswillst. Natürlich kannst du, falls dir dein Ziel zu Beginn noch nicht im Detail klar ist, zu jedem anderen Zeitpunkt im Schreibprozess darauf zurückkommen und an diesem Punkt nochmal feilen.
Theorieteil aufbereiten
Bei den meisten Bachelorarbeiten steht der eigentlichen Analyse, also dem Hautptteil, ein Theoriepart voran. Ich schreibe explizit bei den meisten, denn ob das bei deiner Arbeit zwingend notwendig ist, solltest du vorab einfach mal mit deine:r Betreuer:in abklären.
Beim Theorieteil geht es darum, die für deinen Text und deine Argumentation relevanten wissenschaftlichen Fakten und Forschungsmeinungen zusammenzufassen und Stellung dazu zu beziehen, in dem du sie als Grundlage für deine Erläuterungen und deine These hernimmst und/oder dich eben davon abgrenzt.
Das ist relevant für deine Bachelorarbeit, weil du dadurch den derzeitigen Forschungsstand wiedergibst, dein Thema darin verortest und dich kritisch damit auseinadersetzt – quasi mit dem wissenschaftlichen Diskurs rund um deinen Arbeitsbereich und das ist die Essenz von allen Forschungsarbeiten.
Versuch in diesem Part deines Textes also möglichst genau zu arbeiten und auch gut zu begründen, wieso du der einen Theorie größere Bedeutung für deine Arbeit beimisst als einer anderen. Der Theorieteil sollte auch aktuelle Quellen aufweisen, also auch neuere Perspektiven und Herangehensweisen, von diesem und dem letzten Jahr(en) und sich keinesfalls nur auf einen Forschungsbereich beschränken, der weit zurück liegt.
Hauptteil erarbeiten
Durch deine Gliederung, Einleitung und den theoretischen Teil sollten die Grundlagen so weit stehen, dass du dich mit der eigentlichen Analyse auseinadersetzen kannst, also dem längsten Part deiner Arbeit und damit dem Hauptteil.
Wichtig ist hier ein logischer und kohärenter Aufbau und die Verknüpfung der verschiedenen Bausteine, also vom Thema mit der These, von der These mit der Theorie, von der Argumentation mit den passenden Beispielen, Quellen und Verweisen. In diesem Teil geht es darum überzeugend zu erläutern, wieso genau das von dir ausgesuchte Ergebnis deiner Arbeit ein valider Forschungsansatz ist.
Welche Elemente sind für’s überzeugende Argumentieren wichtig?
- Sinnhaftigkeit: wenn ein Argument absolut keinen Sinn ergibt, weil es unlogisch wirkt, nicht begründbar ist oder sich im Kreis dreht, ist es schlicht kein gutes Argument. Was du schreibst sollte nachvollziehbar und stimmig sein.
- Beweise: jede Aussage, die du triffst, sollte belegbar sein. Das heißt: such dir Beispiele, Zitate oder Ähnliches, die deine Argumentation stützen. Es geht darum zu beweisen, dass das, was du schreibst, nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Ein gutes Argument lässt sich immer irgendwie belegen.
- Aufbau und Struktur: ob du deine Analyse mit dem kleinsten Argument anfängst und mit dem stärksten abschließt, oder Pro- und Contra-Aussagen miteinander abwechselt, bleibt dir überlassen. Nur solltest du das, wofür du dich entscheidest, auch konstant durchziehen. Deine Struktur sollte dabei zu Thema und These passen und zusammen mit dem Aufbau stimmig und sinnig sein. Kommst du beim Denken, Schreiben oder nachträglich Lesen ins Stocken – ist deine Argumentationsstruktur vermutlich noch nicht ganz rund.
- Guter Kenntnisstand: auch bei wissenschaftlichen Texten gilt: sie sollten Wissen und Können ausstrahlen. Natürlich hat eine Bachelorarbeit keine Ausstrahlung an sich, aber auch in einer Abschlussarbeit kannst du zeigen, dass du es drauf hast. Damit ist gemeint: Zeig, dass du gut recherchiert hast und dich allgemein mit dem Thema auskennst – Stichwort Gegenstimmen. Du kannst mit Fußnoten arbeiten und durch diese Anmerkungen einfügen, bspw. über weiterführende Quellen, die aufgrund der Textkürze nicht weiter behandelt werden können. Mach das an Stellen, die passen, übertreib es aber nicht.
Fazit zusammenfassen
Grob kann man sagen: der Schluss ist die Spiegelung der Einleitung. Willst du am Anfang deiner Arbeit einen guten Start hinlegen, solltest du versuchen bis zum Ende durchzuziehen, denn das Fazit ist das Letzte, das der/die Prüfer:in liest – und bleibt somit im Gedächtnis.
Oft lesen Dozierende vor dem Hauptteil erstmal nur Einleitung und Schluss, denn passen die zusammen, ergänzen sich und wird im Fazit alles geklärt, das zu Beginn der Arbeit offen war – ist das ein ausschlaggebender Indikator dafür, dass die Abschlussarbeit allgemein gut ist. Achte also darauf, dass Einleitung und Schluss harmonieren, lies am besten selbst auch mal nur den Beginn und das Ende deiner Bachelorarbeit.
Was ist ein Fazit?
Im Grunde fasst du darin alles für deine Arbeit relevante am Schluss nochmal kompakt zusammen, beziehst Stellung dazu und/oder eröffnest eine neue Perspektive auf den Forschungsgegenstand.
Was darf im Fazit nicht fehlen?
- Thema und These: auch hier solltest du kurz – ähnlich wie in der Einleitung – deinen thematischen Schwerpunkt und deine Forschungsfrage nochmal stellen.
- Zusammenfassung der stärksten Argumente: zum Abschluss gehst du auch nochmal auf deine Argumentation ein und nennst die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu deiner Erkenntnis.
- Die wichtigsten Theorien/Quellen: dabei dürfen auch die Grundpfeiler, also die 1 – 2 relevantesten Urpsrungstheorien und Beweise nicht fehlen.
- Direkte Antwort auf die These: du solltest hier nochmal explizit auf deine Forschungsfrage eingehen und sie beantworten, bzw. deine Ergebnisse und gewonnen Erkenntnisse auf den Punkt bringen.
- Abschluss/Ausblick: um niemanden einfach so aus deinem Text fallen zu lassen, sollte deine Bachelorarbeit abgerundet werden, dass kann durch ein Zitat passieren, durch die Verknüpfung zu einem verwandten Bereich oder aktuellen gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen oder ähnlichen Themen.
Literaturverzeichnis erstellen
Im Literaturverzeichnis gibst du deine Quellen so genau wie möglich an – und zwar alle, also nicht nur die der direkten Zitate, sondern alles, was du für deine Arbeit genutzt hast. Natürlich sollte die Quelle davor schon in einer Fußnote auftauchen.
Dabei gibst du Verfasser:innen/Autor:innen, Herausgebende, Titel des Buches und oder Aufsatzes, Verlag, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, Ausgabe und die Seitenzahlen an. Diese Infos müssen mindestens enthalten sein. Bei Onlinequellen schreibst du auch dazu, wann du die Seite das letzte Mal aufgerufen hast.
Das Wichtigste für dein Literaturverzeichnis sind zwei Dinge:
- Halte dich an die Vorgaben: in den Formatvorlagen für deine Bachelorarbeit wird angegeben sein, wie du zitieren und wie du Quellen im Literaturverzeichnis angeben sollst. Und genau so solltest du es auch machen.
- Achte auf Einheitlichkeit: Zuerst Nachname, zuerst Vorname – Seitenzahl vor oder nach dem Erscheinungsjahr? Egal, wie deine Vorgaben sind, bzw. wie du das machst, zieh es auch durch dein ganzes Verzeichnis durch und wechsel nicht wild durcheinander. Dein Literatur sollte kohärent aufgelistet sein.
Kontinuierlich updaten, dann gibt’s hintenraus keinen Stress
Du musst das Literaturverzeichnis nicht auf einmal und erst nach dem Schreiben deiner Arbeit anlegen. Auch im Schreibprozess kannst du neue Quellen, die du sowieso in die Fußnoten setzen musst, gleich ins Verzeichnis übertragen – und das immer wieder, bei jeder neuen Angabe. So hältst du dein Literaturverzeichnis regelmäßig auf Stand und hast hintenraus weniger Stress.
Anpassungen vornehmen
Steht deine Bachelorarbeit soweit, also ist grundlegend ausformuliert, geht es an die Anpassungen und die Nacharbeit. Mein Tipp ist wirklich alles nochmal durchzugehen, also von der Gliederung bis zum Fazit und grob nachzulesen, ob irgendwo ein großer Haken drin ist, du an einer Stelle hängen bleibst oder Ähnliches. Denn dann solltest du genau dort nochmal ran.
Schau allgemein noch besonders darauf:
- Wird deine Forschungsfrage, These, überzeugend bearbeitet und beantwortet?
- Ist deine Arbeit in sich logisch und nachvollziehbar aufgebaut?
- Hast du für jedes Argument einen Beleg/Beweis?
- Sind alle Quellen angegeben?
- Hast du bei den Fußnoten und im Literaturverzeichnis auf Einheitlichkeit geachtet?
Hast du Anhänge, also Grafiken, Bilder, Diagramme und Co., die Teil deiner Bachelorarbeit sind, ist jetzt die Zeit gekommen alles zusammenzusammeln, und hinter dem Literaturverzeichnis einzufügen. Da gehören alle deine Anhänge hin.
Korrigieren
Wenn du es bis hierhin geschafft hast, erstmal: Glückwunsch. Denn damit ist das Gröbste für deine Bachelorarbeit erledigt – jetzt geht es nur noch ans Feintuning, also die Korrektur.
Dafür würde ich dir raten, das dreischrittig zu machen, heißt deine Arbeit insgesamt 3x selbst Korrektur zu lesen und dich jedes Mal auf einen anderen Bereich zu fokussieren. Gleichzeitig auf alles aufzupassen steigert die Fehlerquote, also, dass du Tippfehler und Co. einfach überliest.
Bei der ersten Korrektur kannst du den Fokus auf Inhalt und Logik setzen. Du schaust dir an, ob das, was du geschrieben hast, strukturiert und stimmig ist und Sinn ergibt: die einzelnen Sätze, Absätze, Kapitel aber auch die gesamte Arbeit. Im zweiten Schritt schaust du dir deine Sprache und Grammatik an: hast du die Fachwörter richtig verwendet, sind die Kommata an der passenden Stellen, findest du noch Tippfehler? Bei der dritten Korrektur überprüfst du nochmal die Formalien, also Formatierungen, Schriftgröße, Fußnoten, Zitation, Quellenangaben, Verzeichnis und Anhänge.
Zweitkorrektur – 4-Augen-Prinzip
Mein Tipp ist auch: Lass mindestens noch eine andere Person über deine Bachelorarbeit drüber lesen, bevor du abgibst. Beschäftigt man sich selbst zu lange mit einem Text, kann es sein, dass man die eigenen Fehler einfach nicht mehr sieht.
Zeitproblem? Du schaffst es nicht 3 Mal deine Arbeit Korrektur zu lesen und noch jemanden anderen korrigieren zu lassen? Dann fokussier dich darauf in einem Schritt möglichst viele Fehler selbst zu beseitigen und gleichzeitig noch von einer anderen Person korrigieren zu lassen.
Deckblatt und eidesstattliche Versicherung nicht vergessen
Bevor du deine Abschlussarbeit abgeben kannst, sind noch zwei Dokumente essentiell – für beide solltest du über deinen Lehrstuhl/deine Fakultät Vorlagen oder Vordrucke finden können:
- Deckblatt: das Deckblatt wird ganz vorne, also als erste Seite deiner Arbeit (aber ohne Seitenzahl) eingefügt. Darauf nennst du deine Fakultät, dein Fach, den Titel deiner Bachelorarbeit, deinen Namen und deine Kontaktdaten, deine Matrikelnummer, in welchem Semester du dich gerade befindest, Bachelor- oder Masterarbeit, den Namen deine:r Prüfer:in und das Abgabedatum.
- Eidestattliche Versicherung/Erklärung: mit diesem Dokument versicherst du, dass du deine Abschlussarbeit eigenständig, ohne fremde Hilfe etc., verfasst hast. Du findest es über deinen Lehrstuhl oder das Prüfungsamt, druckst es aus, füllst es aus und hängst es i.d.R. ganz hinten an deine Arbeit dran – also als letzte Seite. Frag aber gerne nochmal deine:n Betreuer:in, denn an einigen wenigen Universitäten wird die Erklärung gleich nach dem Deckblatt in die Abschlussarbeit eingeheftet.
Abgeben
Zwar werden die meisten Bachelorarbeiten ausgedruckt und gebunden eingereicht, mit einem USB-Stick oder Ähnlichem, auf dem deine Arbeit nochmal digital enthalten ist – trotzdem solltest du dich rechtzeitig informieren, ob das auch bei deiner Arbeit der Fall ist oder andere Vorgaben eingehalten werden müssen. Das klärst du mit deine:r Betreuer:in.
Falls du deine Abschlussarbeit binden oder laminieren lassen musst, solltest du Zeit dafür einplanen. Je nachdem, an welchem Wochentag deine Frist endet und wie viele andere Studierenden auch noch zum Copy Shop müssen, kann das zwischen ein paar Minuten bis, im Worstcase, zu 2 Tagen dauern.
Halte unbedingt die Abgabefrist ein – auch, wenn sie auf einen Samstag/Sonntag/Feiertag fällt. Außer in dem Dokument, dass du für die Bestätigung der Anmeldung deiner Arbeit bekommen hast, steht etwas anderes.
Auf Ergebnis warten
Nach der Abgabe heißt es erstmal abwarten, denn die Prüfer:innen haben i.d.R. bis zu 8 Wochen Zeit deine Bachelorarbeit zu korrigieren. Du solltest dir dabei auch einfach keinen großen Kopf machen, denn selbst, wenn du durchgefallen sein solltest – was wirklich selten passiert – gibt es die Möglichkeit zu wiederholen.
Mit dem Ergebnis kannst du dann übrigens auch die Korrektur einsehen und das solltest du auch machen, denn für den Fall, dass du weiterstudieren möchtest und nicht gerade mit einer 1,0 bestanden hast, kannst du darin sehen, in welchen Bereichen noch Luft nach oben ist.
(SALI)